Darum gibt es in Luxemburg immer weniger Gemeinden
Veröffentlicht
von
Yves Greis
am 18/02/2025 um 17:02

Bei Gemeindefusionen schließen sich kleine Gemeinden zu einer größeren Gemeinde zusammen, mit dem Ziel, ihre Kräfte zu bündeln und so besser für die Bürgerinnen und Bürger da sein zu können. Meist fusionieren dabei zwei Gemeinden, manchmal sind es aber auch drei. Die Gemeindeverwaltung verfügt so über Möglichkeiten, die kleine Gemeinden nicht haben.
Ein Beispiel sind Schulen. Für eine kleine Gemeinde mit nur 300 Einwohnern ist es nicht sinnig, einen eigenen Schulkomplex zu bauen und zu betreiben. Die Kinder besuchen dann die Schule in der Nachbargemeinde. Ähnlich verhält es sich mit Schwimmbädern. Eine kleien Gemeinde hat nicht immer ihre eigenen Freizeiteinrichtungen. Dann macht es unter Umständen Sinn, dass sich die Gemeinden, die sowieso schon lange zusammenarbeiten, zusammenschließen. Inklusive eines einzigen Gemeinderates und Bürgermeisters.
Dabei gehen in der Regel keine Arbeitsplätze verloren, weil die Arbeit die gleiche bleibt. Aber es kann zum Beispiel am Fuhrpark gespart werden, wenn zum Beispiel nur eine Kehrmaschine angeschafft werden muss, anstatt drei. Ein Nachteil kann sein, dass die Wege zur Gemeindeverwaltung für die Bürger etwas weiter werden, wenn aus drei Gemeindeverwaltungen eine einzige wird. “Ich habe noch nie gehört, dass jemand eine Gemeindefusion bereut hat”, sagt Gérard Koob. Er ist Direktor der interkommunalen Organisation Syvicol.
Unterstützung von der Regierung
Die Luxemburger Regierung hat kein angestrebtes Ziel und will auch keine Gemeindefusionen erzwingen. Dass sie Gemeindefusionen nicht abgeneigt ist, zeigt sich im Koalitionsabkommen: “Die Regierung unterstützt weiterhin Gemeinden, die den Wunsch haben zu fusionieren”, heißt es da. Die Zusammenschlüsse werden sogar finanziell unterstützt. Zu diesem Zweck hat der Regierungsrat am Freitag, 14. Februar, beschlossen, eine “unabhängige Zelle” zu diesem Thema einzurichten. Darin sollen Menschen aus anderen Gemeinden sitzen, die auf die Fragen von fusionswilligen Gemeinden eingehen können.
Bei der praktischen Umsetzung stoßen die Gemeinden immer wieder auf ähnliche Herausforderungen. Gérard Koob berichtet aus seiner persönlichen Erfahrung mit der Fusion der Gemeinde Esch-Sauer in 2011 (es fusionierten Esch-sur-Sûre, Heiderscheid und Neunhausen). “Die allgemeinen Bebauungspläne mussten einander angepasst werden und die Gemeindetaxen mussten harmonisiert werden”, erinnert er sich. Auch wann die allermeisten Bebauungspläne heute nach den gleichen Regeln aufgestellt sind – es gibt viele kleine und zum Teil bürokratische Entscheidungen also, die bei den Gemeindevätern und Beamten für Kopfzerbrechen sorgen können.
Dafür gibt es viele Gemeinden, die bereits fusioniert haben und ihre Erfahrung teilen können. Die neue Beraterzelle könnte hier helfen.
Schlussendlich entscheiden aber die Bürger, ob ihre Gemeinden fusionieren. Vor jedem Zusammenschluss soll ein Referendum stattfinden. Auch das bekräftigte auch die Regierung in ihrem Koalitionsabkommen. Die Fusion wird schließlich im Parlament abgesegnet. Eine Fusion wird immer durch ein eigenes Gesetz offiziell gemacht.
- Zu lesen> Kein Feiertag für den Thronwechsel
“In der Vergangenheit gab es mehrere Wellen von Fusionen”, berichtet Koob. Hervorzuheben ist das Jahr 1920, als die Gemeinden Luxemburg, Eich, Hamm, Hollerich und Rollingergrund sich zusammengeschlossen haben, um die heutige Gemeinde Luxemburg-Stadt zu gründen. Es folgten vier weitere Gemeinden in den 1970er Jahren (Junglinster, Stauseegemeinde, Rambruch und Wintger). Dann war es lange Zeit ruhig. Der Zähler stand seitdem auf 118 Gemeinden.
Dann 2004 traten die Gemeinden Bastendorf und Fuhren mit ihrer Fusion zur Gemeinde Tandel eine neue Welle der Fusionen los. Das Fusionsfieber setzte ein und die Zahl der Luxemburger Gemeinden ging über 20 Jahre stetig zurück, um heute 100 zu erreichen.
Heute liegt noch ein großes Dossier auf dem Tisch: die Fusion der vier (oder fünf) Gemeinden Diekirch, Ettelbruck, Schieren, Erpeldange-sur-Sûre (oder sogar Bettendorf) zur Nordstad. Damit würde ein einheitliches Gebilde mit 24.000 Einwohnern entstehen.
Wie bei jeder Fusion müssen zunächst die gewählten Vertreter ihre Meinung äußern, doch das letzte Wort haben die Bürger. Tatsächlich ist es immer das Ergebnis eines Referendums, das eine Fusion bestätigt oder ablehnt. So scheiterte vor knapp zehn Jahren die „Ehe“ zwischen Larochette, Nommern und Fischbach. Mehr als 70% der Wähler in Nommern und Fischbach stimmten gegen die Fusion, obwohl 66% der Wähler in Larochette sie wollten...
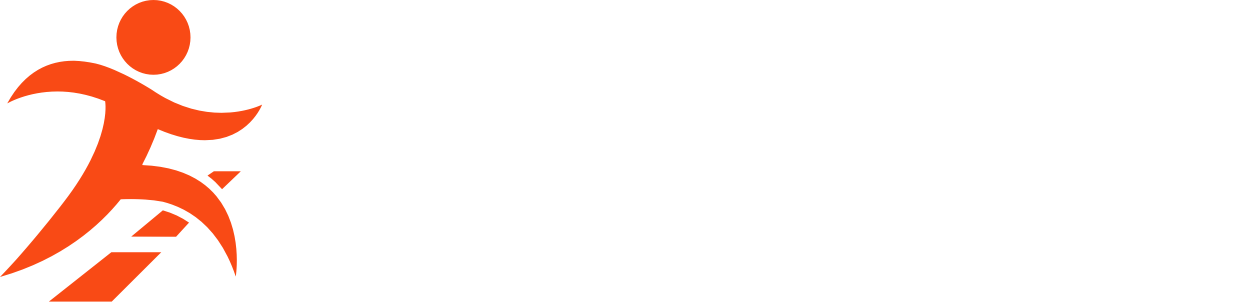







































































Um einen Kommentar zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich.