Wenn Rechenzentren Ihre Heizung ersetzen
Veröffentlicht
von
Patrick Jacquemot
am 04/02/2025 um 12:02

Es wird immer mehr Rechenzentren geben, in denen unsere Computerdaten gespeichert und verwaltet werden. Dasselbe gilt für Supercomputer. Beide Technologien haben die doppelte Besonderheit, dass sie viel Energie verbrauchen und Wärme abgeben. Eine Abwärme, die man nicht einfach in die Luft gehen lassen sollte. Daher hat Deutschland beschlossen, dass ab 2026 jedes Rechenzentrum, das in Betrieb genommen wird, eine Lösung zur Umverteilung dieser Hitze anbieten muss.
Wird Luxemburg diesem Gesetz folgen? Zum jetzigen Zeitpunkt verspricht der Wirtschaftsminister dies nicht. Andererseits: in einer Zeit, in der das Land versucht, seine CO₂-Emissionen zu reduzieren und verantwortungsvoller mit seinem Energieverbrauch umzugehen, kommt es auch nicht in Frage, sich diese „thermische Ader“ entgehen zu lassen! Lex Delles versichert, dass in Zukunft „die Rechenzentren in das nationale Wärmeregister aufgenommen werden. Sie werden dann Teil eines Wärmeplans sein, der auf kommunaler und nationaler Ebene verfügbar ist“.
Aber bereits ein Akteur wie Luxconnect hat die Vorteile der Nutzung dieser Hitze erkannt. Dies ist der Fall an seinem Standort in Bissen, wo die Wärme, die durch den Betrieb der Meluxina-Server abgegeben wird, aufgefangen wird. Einerseits wird sie dazu verwendet, das Holz zu trocknen, das einige Meter entfernt in der Kiowatt-Fabrik verarbeitet wird. Dieses Holz wird unter anderem für die Herstellung von Pellets verwendet. Andererseits wird diese Wärme umgewandelt, um die Anlagen zu kühlen.
Wohnraum, Kulturen, Schwimmbäder…
Da sich diese Technologien jedoch weiterentwickeln werden, ist es durchaus angebracht, über eine Nutzung dieser größtenteils „verlorenen“ Wärme in größerem Maßstab nachzudenken. In Belgien hat sich ein Luxconnect-Standort mit dem Heizungsnetz eines Stadtviertels verbunden. In Deutschland wird ein Rechenzentrum der Universität Stuttgart als Heizkörper dienen. In der Schweiz werden 6.000 Wohnungen in Genf direkt von einem neuen Rechenzentrum aus beheizt. Dies sind nur einige Beispiele von vielen.
Es wird geschätzt, dass ein „kleines Rechenzentrum“ (1 MW) so viel Wärme erzeugt wie etwa 1.000 Elektroheizungen! Ein „großes Rechenzentrum“ (50 MW) kann zur Wärmeversorgung einer ganzen Stadt beitragen.
- Zu lesen> Luxemburg bekommt seine eigene Cloud
Am häufigsten wird dieses „elektronische Fieber“ für die Fernwärmeversorgung genutzt (um die Wassertemperaturen in Schwimmbädern, Büros oder Wohnungen kostengünstig zu erhöhen).
Das Verfahren wird auch genutzt, um das Quecksilber in landwirtschaftlichen Gewächshäusern steigen zu lassen, oder für Industrieunternehmen, die für ihre Produktionsprozesse einen hohen Bedarf an heißem Wasser haben.
- Zu lesen> Diese App könnte ChatGPT ersetzen
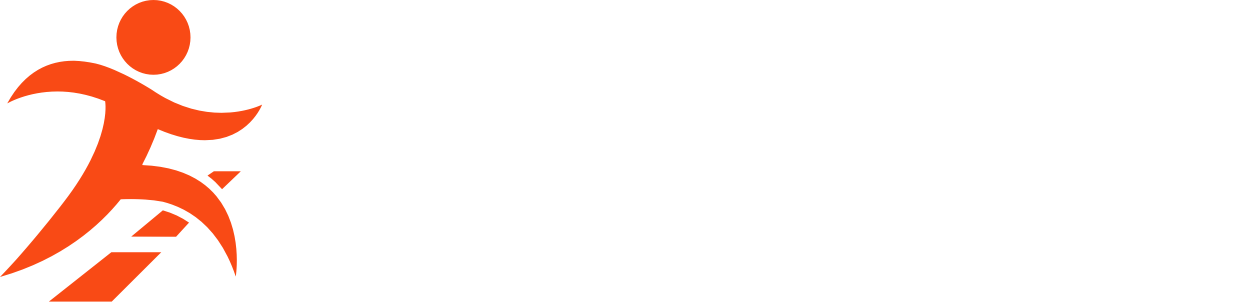






































































Um einen Kommentar zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich.